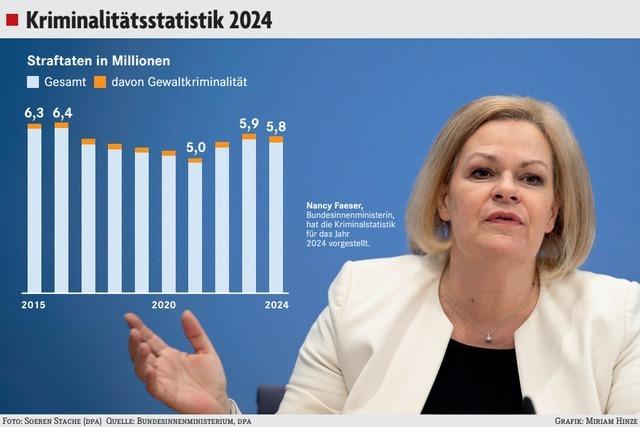"Sej a Mensch"
Als Vertreter der zweiten Shoah-Generation hat der 1949 in Polen geborene Sportreporter Marcel Reif im Bundestag über seinen Vater gesprochen, der den Holocaust knapp überlebt hat. Wir dokumentieren die Rede.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen

Sie, Frau Szepesi, sprechen, und mögen Sie das noch lange tun. Mein Vater hat geschwiegen und für dieses lebenslange Schweigen möchte ich ihm hier und heute danke sagen, weil ich es zu seinen Lebzeiten versäumt habe. Als sich Anfang der 50er-Jahre in Polen, wo wir lebten, wieder antisemitische Strömungen breitzumachen drohten, beschlossen meine Eltern, vor allem mein Vater: Einmal ist genug! Er hatte den Holocaust überlebt, die meisten aus seiner Familie nicht.
Über den nicht geglückten Umweg Israel zog die Familie nach Deutschland, in das Land der Täter. Aber hier waren Freunde, waren Verwandte, die helfen konnten. Hier fanden wir ein Dach über dem Kopf, hier fand mein Vater Arbeit, um die Familie durchzubringen. Das neue, andere Deutschland bot ihm jetzt eine zweite Chance auf: anständiges, würdevolles Leben.
Und hier wuchsen meine Schwester und ich auf – eine fröhliche, sorgenfreie, liebevolle Kindheit und Jugend. Fröhlich und sorgenfrei nicht zuletzt – das weiß ich heute –, weil mein Vater schwieg. Kein Wort über all das, was er erlebt, überlebt hatte. Er sprach nicht und ich fragte nicht. Ich würde gern behaupten: weil es seine Entscheidung war und ich sie respektiert habe. Vielleicht auch. Aber vor allem war es meine Angst, Angst, Unsagbares hören, Unfassbares erfassen und Unerträgliches ertragen zu müssen: Bilder des Grauens, was man meinem großen, starken Vater angetan hatte. Die Wahrheit war doch eindeutig: Ich hatte keine Großeltern, ein Onkel, eine Tante, eine Cousine waren geblieben, die anderen: ermordet.
Jahre nach Vaters Tod war offenbar ein Schweigegelöbnis seiner Frau, unserer Mutter abgelaufen. Ich wollte jetzt wissen und sie durfte sprechen. Vater war ein liebevoller, ein guter Opa. Einmal die Woche kam ich mit meinem kleinen Sohn zu Besuch. Es waren wunderbare Stunden. Nur manchmal verfiel er kurz in eine Depression, wurde für ein paar Minuten unerreichbar. Ich fand das angesichts seines kleinen Enkels unangemessen und war einmal drauf und dran, mich dazu zu versteigen, ihn dafür tadeln zu wollen. Da fuhr meine Mutter dazwischen. Sie machte so eine Handbewegung und sagte: "Du weißt ja gar nichts!".
Zum Glück habe ich reagiert auf dieses Durchparieren und meinen Mund gehalten. Weil ich zwar nicht wusste, aber offenbar sehr wohl ahnte: Da ist etwas, viel zu groß, viel zu furchtbar. Mutter erzählte, wie eine Gruppe Juden mit meinem Vater auf der Flucht einen kleinen Jungen – ungefähr so alt wie sein Enkel – bei polnischen Bauern zurückließ, um überhaupt eine Chance zu haben. Nach der Befreiung wollten sie den Jungen wieder abholen. "‚Es tut uns leid. Die Deutschen kamen und da mussten wir das Kind die Klippe runterwerfen.‘ Und weißt Du: Jedes Mal, wenn Du mit Deinem Sohn bei uns warst, hatte er auch diesen Jungen vor Augen." Hätte ich ihn fragen sollen, fragen müssen: warum? Wäre es richtiger gewesen, besser, leichter für ihn und für mich? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich genau: Ich bin der letzte, dem es zusteht, darüber zu urteilen.
Im Nachhinein sowieso. Viel zu gern hatte ich als Kind und junger Mann diesen warmen, kuscheligen Mantel seines Schweigens angenommen, mich darin eingerichtet mit den Sorgen und Problemen eines Nachkriegs-Wirtschaftswunder-Sprößlings: die Lateinnote, Form und Farbe des ersten Autos, die Fußballerkarriere – Gegenwart nur und rosige Zukunft. Die Vergangenheit habe ich erst 50 Jahre später wirklich angenommen in den Gesprächen mit meiner Mutter.
Wobei, Gespräche? Drei Tage haben wir uns hingesetzt, sie hat erzählt, wir haben viel gelacht und noch mehr geweint. Und sie hat am Ende bestätigt, besiegelt, was mein Vater gewollt und geschafft hatte, nämlich: Es durfte nicht sein, dass auch seine Kinder von den furchtbaren Schatten heimgesucht, gequält werden, die seine Kindheit und Jugend verdunkelt, zerstört hatten. Wir sollten, wir durften nicht in jedem Postboten, Bäcker, Straßenbahnfahrer einen möglichen Mörder unserer Großeltern vermuten. Eine behütete, unbelastete, unbeschwerte Kindheit sollte es sein.
Er wollte diesen verschlossenen Raum in unserem Lebenshaus nicht einen Spalt breit öffnen. Auch nicht für die guten Geister, die da ebenfalls wohnten: So hatte ihn der spätere Krupp-Manager Berthold Beitz aus einem Todeszug Richtung Vernichtungslager geholt und ihm das Leben gerettet. Ohne Beitz würde ich heute nicht hier stehen. Und vor ein paar Jahren sprach mich ein Mann auf der Straße an, ob ich ein paar Minuten hätte, er wolle mir etwas über meinen Vater berichten: Auf der Flucht durch die Wälder hatte Vater den Vierjährigen auf den Schultern getragen und ihm so das Leben gerettet.
Das alles weiß ich heute. Und noch etwas habe ich endlich, viel zu spät, erkannt, begriffen, und das ist das Bedeutendste: Ich erinnere mich nicht an den Anlass und den Zeitpunkt, aber mir wurde irgendwann schlagartig klar, dass mein Vater ja doch gesprochen hatte und mir das gesagt und mitgegeben hatte, was ihm wichtig war, was er gerettet, was er als Essenz destilliert hatte aus dem Unmenschlichen der Häscher und Mörder, aus dem Übermenschlichen eines so mutigen Berthold Beitz; aus dem, was er selbst geleistet hatte mit dem kleinen Jungen, der seine eigene Menschlichkeit abgefragt hatte. All das hat er in einen kleinen Satz gepackt. Und ich erinnere mich täglich mehr, wie oft er mir diesen Satz geschenkt hat. Mal als Mahnung, mal als Warnung, als Ratschlag oder auch als Tadel: Drei Worte nur in dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse: "Sej a Mensch." Sei ein Mensch. ( …)