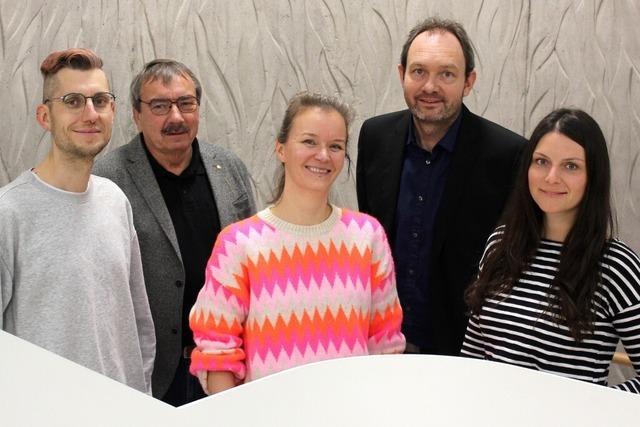Abfallwirtschaft
Wie KI im Kreis Lörrach hilft, falsche Abfälle in den Biotonnen zu erkennen
Die Abfallwirtschaft im Kreis Lörrach setzt auf KI-Detektion zur Reduzierung von Fremdstoffen in Biotonnen. Neue Kameratechnik analysiert den Inhalt direkt am und im Fahrzeug. Das klappt nicht immer.
Do, 3. Apr 2025, 8:00 Uhr
Kreis Lörrach
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen

Mit dem Beginn des neuen Sammel- und Transport-Vertrages für den Bioabfall zum 1. Januar hat der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Kreis Lörrach die Detektion – also das Aufspüren von falsch, beispielsweise mit Kunststoff befüllten Biotonnen – ausgeweitet. Entsprechend bleiben seither mehr Biotonnen stehen, sagt Pressesprecherin Anna Sebastian. "Die Situation hat sich nun eingespielt, und ein gewisser Lerneffekt ist zu beobachten." Auswertungen der Zahlen stehen jedoch noch aus.
Wird eine falsch befüllte Tonne erkannt, wird diese für die Leerung gesperrt und mit einem roten Anhänger versehen. Kunden müssen sich bei der Abfallwirtschaft melden und mitteilen, wie sie die Fehlbefüllung beseitigen. Sie können die Störstoffe aussortieren und die entsperrte Biotonne bei der nächsten Leerung bereitstellen. Oder sie beauftragen eine kostenpflichtige Leerung der Biotonne bei der nächsten Restmüllabfuhr.
Aktuell sind acht Sammelfahrzeuge mit der Detektionstechnik ausgestattet. Davon fahren aber nur drei mit Detektion. "Wir benötigen noch weitere Erfahrungswerte", erklärt Sebastian. Zudem könne der Eigenbetrieb mit seinen personellen Kapazitäten nur eine begrenzte Anzahl an detektierten Biotonnen bearbeiten. Vorgesehen sei, die Detektion schrittweise auszuweiten.
Eingesetzt wird ein KI-gestütztes System der Firma c-trace. Dabei ist die Kameratechnik um eine Software ergänzt, die sich auf Künstliche Intelligenz (KI) stützt und die Bilder vom Inhalt der Biotonnen direkt am Fahrzeug analysiert.
System mit zwei Komponenten
Das System verfügt über zwei Komponenten: Topview erkennt Fremdstoffe an der Oberfläche der Biotonne. Insideview scannt die Abfälle nach der Leerung in der Schüttung des Fahrzeuges. Die Topview-Komponente besteht aus zwei KI-Kameras über der Schüttung am Heck des Sammelfahrzeugs. Diese fotografieren und scannen die Oberfläche des geöffneten Behälters und stoppen die Entleerung automatisch, sobald Störstoffe, etwa Plastik, erkannt werden. Bei der Insideview-Komponente befinden sich zwei KI-Kameras seitlich im Schüttraum des Fahrzeuges. Diese nehmen hochauflösende Bilder vom Abfall auf, nachdem er ins Fahrzeug gekippt worden ist. Durch diese Aufnahmen kann der Bioabfall dem Behälter zugeordnet werden und der Nutzer ein Feedback zu der Fehlbefüllung erhalten. Derzeit nutze die Abfallwirtschaft diese Funktion aber noch nicht, erklärt Sebastian.
Die Technik gewährleiste eine gründliche Kontrolle und ermögliche das Erkennen von Fremdstoffen, unabhängig davon, ob sie an der Oberfläche sichtbar sind oder tiefer im Behälter versteckt liegen. Sichtkontrollen seien nicht mehr notwendig. Für eine Bewertung der KI-Detektion sei es noch zu früh, da die gesammelten Daten noch ausgewertet werden müssen, erklärt Anna Sebastian.
Vor einigen Wochen gab es Probleme, weil die KI Zellulose-Tüten nicht erkannt hat. Laut Abfallwirtschaft bisher ein Einzelfall. Das sei der Tatsache zu verdanken, dass im Vorfeld der Entsorger bereits mehrjährige Tests durchgeführt hatte, um die KI-Software anzulernen, erläutert Anna Sebastian. Zum Beispiel wurde ihr das Beurteilen von Bäckereitüten beigebracht. Je nach Tageszeit seien derzeit vereinzelt die Belichtungsverhältnisse noch nicht optimal.
2016 hat der Landkreis die separate Sammlung von Bioabfällen mit Biotonnen eingeführt. Waren 2020 knapp 40.000 Behälter im Einsatz, stieg deren Zahl bis 2024 auf fast 46.000. Aktuell sind es – über alle Größen – 45.238 Biotonnen. Der Rückgang hat mit einer Systembereinigung im vergangenen Jahr zu tun. Dabei wurden Biotonnen, die länger als ein Jahr nicht genutzt worden sind, abgemeldet. Parallel zu den Tonnen wuchs auch die Zahl der Leerungen: 2020 waren es 753.585, 2024 schon 827.290. Auch die Menge der gesammelten Bioabfallmengen wuchs – von 14.308 Tonnen im Jahr 2022 nach einem leichten Rückgang 2023 auf 15.262 Tonnen im vergangenen Jahr. Die Anschlussquote lag 2022 bei 48 Prozent der Haushalte. Seither ist sie laut Abfallwirtschaft leicht gestiegen. Die aktuelle Auswertung steht aber noch aus.
gra
Im Nachbarlandkreis Waldshut werden immer wieder statt roter Karten für falsch befüllte Tonnen grüne Karten verteilt, um Haushalte, die ihren Bioabfall vorbildlich erfassen, zu loben. Ein vergleichbares Vorgehen ist im Kreis Lörrach nicht geplant. Dies würde für die Müllwerker einen erheblichen Mehraufwand bedeuten und zu Mehrkosten führen, erklärt Sebastian. Zudem habe man den Druck weiterer Anhänger aus ökologischen Überlegungen verworfen. Über die Inside-View Detektion wäre es technisch möglich, Nutzern zum Beispiel per E-Mail oder über die Abfall-App ein positives Feedback zu geben. Diese Möglichkeit sei aber noch nicht geprüft.
Ziel der Detektion sind qualitativ möglichst hochwertige Bioabfälle, wie sie für die Verwertung benötigt werden. Vor Ausweitung der Detektion lag der Anteil von Fremdstoffen bei rund fünf Prozent. Von Mai an treten Änderungen der Bioabfallverordnung in Kraft, die strengere Regeln vorsehen. Der Fremdstoffanteil darf bei Anlieferung an der Vergärungsanlage in Freiburg künftig maximal drei Prozent betragen. Sind es mehr, können die Anlieferungen zurückgewiesen werden und müssen als Restmüll entsorgt, also in Basel verbrannt werden. Ziel sei es daher, den Fremdstoffanteil auf höchstens drei Prozent zu verringern.
- Überfordert: KI erkennt Zellulose-Tüten im Biomüll noch nicht
- Neuerungen: Was sich bei der Abfallwirschaft 2025 ändert
- Rückblick: Bioabfälle werden weiterhin in Freiburg verwertet