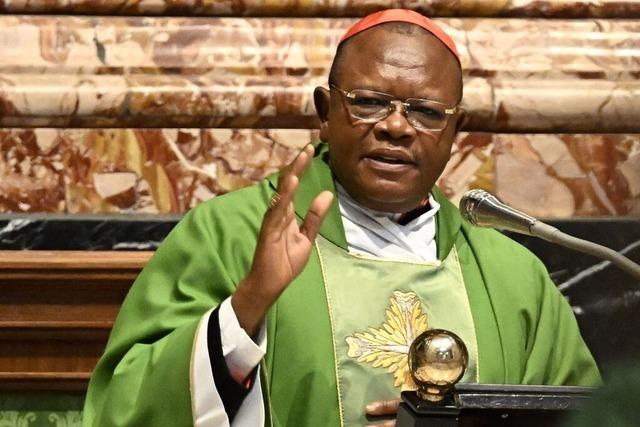Analyse
Was hat die Artenschutzkonferenz in Südafrika gebracht?
Auf der Welt-Artenschutzkonferenz in Südafrika haben Naturschützer großartige Triumphe errungen. Aber es gibt auch Schönheitsfehler - denn nicht jede Tierart kommt gleich gut weg. Eine Analyse von Johannes Dieterich.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen
Zugegeben, es gab auch kleine Schönheitsfehler. Vor allem auf Betreiben der südafrikanischen Gastgeber wurde der umfangreichste Schutz nicht auf die im südlichen Afrika lebenden Elefanten ausgedehnt, was am weltweiten Verbot des Elfenbeinhandels allerdings nichts ändert. Knochen, Klauen und Zähne von in Gefangenschaft aufgewachsenen Löwen dürfen weiter gehandelt werden; hier hat sich die Lobby der südafrikanischen Löwenfarmer durchgesetzt, die ihre zahmen Großkatzen von ausländischen Jägern schießen lassen und deren Bestandteile anschließend nach Asien verkaufen. Der König ist in diesem Fall der Kommerz.
In diesem Fall? In Wahrheit gilt das unsentimentale amerikanische Bonmot "It’s the economy, stupid" längst auch in Afrikas Wildnis. Wenn Ranger in Nationalparks die Spur von Wilddieben verfolgen wollen, müssen sie die Spur des Geldes aufnehmen: Wilderei ist keine Naturkatastrophe, sondern in erster Linie ein Mega-Geschäft. Genau wie der Naturschutz längst kein ehrenamtlicher Sonntagsjob für gute Menschen mehr ist. Er wird von hochqualifizierten Managern und ganzen Armeen von Wildhütern geführt, die bezahlt und ausgerüstet werden müssen.
Ein Problem ist das weder für die von Spenden finanzierten Naturschützer noch für die Regierungen der Industriestaaten, in denen der Lebensraum für wilde Tiere selbst immer weiter zusammenschrumpft. Beide erwarten jedoch, dass die Staaten jenseits des Äquators das noch übrig gebliebene Welterbe hegen: Schließlich wollen Touristen aus Zürich, Berlin und London auch noch in zwanzig Jahren archaisch anmutende Rhinozerosse, majestätische Rüsseltiere und tobende Paviane sehen. Allerdings bringen die Besucher nicht genug Geld mit, um die Naturreservate, die in einigen afrikanischen Staaten wie in Tansania fast ein Drittel der Landesfläche abdecken, auch wirtschaftlich lohnenswert zu machen. Kaum ein afrikanischer Nationalpark kann sich selbst finanzieren. Deshalb sind Parkbehörden und Regierungen vor allem in wirtschaftlich weiter entwickelten Staaten wie Südafrika dazu übergegangen, nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten zu fahnden. Dazu gehören unter anderem die Großwildjagd, Tierauktionen, Privatparks – und der Handel mit den Knochen zahmer Löwen.
Fachleute wissen, dass Schutzmechanismen ganz und gar wirkungslos sind, wenn sie von der Bevölkerung nicht anerkannt werden. In Ghana starb der graue Papagei aus, obwohl er nicht gehandelt werden durfte, in Tansania werden Elefanten massakriert, obwohl die Dickhäuter dort unter höchstem Schutz stehen. Wilderer sind zumindest auf die Mithilfe der lokalen Bevölkerung angewiesen. In den meisten Fällen kaufen die internationalen Verbrecherbanden lediglich die Trophäen der von den Einheimischen getöteten Tiere auf.
Nur wenn die Anwohner der Parks in den Tierschutz einbezogen werden, haben die Handelsverbote Aussicht auf Erfolg. Dazu muss für die Bevölkerung der Wert eines lebendigen Elefanten den eines toten übertreffen – ein Prinzip, das wichtiger ist als 35 000 Konventionsartikel des Abkommens.
"It’s the economy, stupid!" Wenn die Internationale der Naturschützer und die Regierungen der Industrienationen den unsentimentalen Grundsatz nicht in ihr Kalkül mit einbeziehen, werden sämtliche Schutzmaßnahmen scheitern.