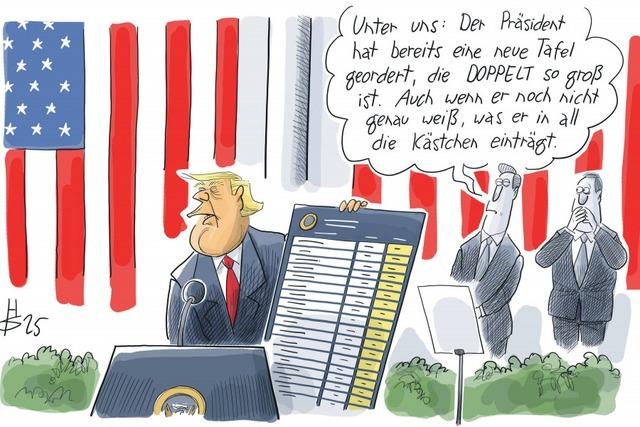Abchasien
Die etwas andere Weltmeisterschaft
In Abchasien treffen sich die Fußball-Nationalmannschaften der nicht anerkannten Staaten zu ihrem großen Turnier.
Nik Afanasjew
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen
Die grün-weißen Nationalflaggen in den Händen der Zuschauer zeigen oben links eine Hand, die "Stop!" zu sagen scheint. Diese Flagge taucht in keinem Schulbuch auf. Das Stadion ist ausverkauft, aber es fasst nur einige Tausend Menschen. Und das so schick funkelnde Grün ist Kunstrasen. Echt hingegen ist die Begeisterung der Menschen im Stadion. Sie sind so enthusiastisch, wie nur Fußballfans sein können, die zum ersten Mal die Welt bei sich zu Gast haben. Willkommen in der Republik Abchasien, bei der Fußballweltmeisterschaft der Conifa.
Die Conifa ist nach der Fifa der zweitgrößte weltweit tätige Fußball-Dachverband. Ihre Mannschaften repräsentieren vor allem nicht anerkannte Staaten, staatenlose Völker. Teilnehmer der gerade laufenden WM sind beispielsweise Kurdistan, Padanien, Somaliland und Nord-Zypern. Gastgeber Abchasien gehört völkerrechtlich zu Georgien, ist de facto aber ein unabhängiger Staat, der nur von Russland, Venezuela, Nicaragua und Nauru anerkannt wird. Russische Finanzhilfen und Touristen halten das Land am Schwarzen Meer mit seinen 240 000 Einwohnern über Wasser. Das muss sich ändern, meint Rafael Ampar.
Ampar, Jahrgang 64, weißer Anzug, lichtes Haar, melancholischer Blick, war als stellvertretender Sportminister an der Turnierorganisation beteiligt. Kurz bevor der abchasische Präsident in der Hauptstadt Suchumi die alternative WM für eröffnet erklärt, verfolgt Ampar die Eröffnungsfeier von hinter einer Bühne. "Wir brauchen Russland, aber wir sollten uns nicht auf ein Land fokussieren", sagt Ampar, ohne den Blick von den vielen Tänzern abzuwenden, die das Fest wie besonders farbenfrohe Ritterspiele aussehen lassen. Die Geschichte der Abchasen ist ein Kampf darum, im eigenen Land nicht marginalisiert zu werden. Immer wieder wurden sie durch gezielte Ansiedlung anderer Völker zur Minderheit im eigenen Land, fühlten sich unterjocht, zuletzt kamen in der Sowjetzeit die Georgier. Der Krieg 1992/93 gegen das Brudervolk brachte die Unabhängigkeit. 20 000 Menschen starben, Hunderttausende wurden vertrieben. Die Wunden sitzen bis heute tief. Auch Ampar hat gekämpft.
"Wir wollen wie alle Völker in Frieden leben", sagt er heute. Wichtig sei nicht nur, dass die Abchasen die Mehrheit in ihrem Land stellen, wie es aktuell knapp der Fall sei, sondern der Aufbau einer wirtschaftlichen Basis. "Es geht nicht nur um unsere Quantität, sondern um Qualität, um die Entwicklung der Fähigkeiten unseres Volkes", sagt Ampar. Als er Kinder an einem historischen Katapult toben sieht, das für die Eröffnungsfeier bereitsteht, eilt er hin, mahnt sie zur Vorsicht und entlässt sie mit freundlichem Klaps. Dann spricht Rafael Ampar von dem Paradoxon, wie er es nennt: "Ohne russische Investitionen geht es nicht, aber zu viel russischer Einfluss würde uns wieder an den Rand drängen." Er sieht die Menschen im Stadion jubeln, lächelt kurz. Die Feier endet mit einem Feuerwerk. Der Weg ins russische Protektorat Abchasien über das vom Westen unterstützte Georgien ist kompliziert. Die Grenze, die es offiziell nicht gibt, ist schwer bewacht. Über den Grenzfluss Enguri geht es nur zu Fuß oder auf einem Pferdekarren. Die Straße nach Suchumi schlängelt sich zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus, das Grün ist üppig, die Hügel malerisch. Gerade im Kontrast dazu wirken die allzu vielen zerstörten Gebäude besonders apokalyptisch. Am besten gepflegt sind Kriegsdenkmäler. Neben den Stränden gehören Sommerhäuser des früheren Sowjetdiktators Stalin zu den touristischen Höhepunkten.
Dass dieses abgelegene Land eine alternative WM ausrichten darf, verdankt es einem Deutschen. Sascha Düerkop ist 29, stammt aus Köln, ist studierter Mathematiker und Generalsekretär der Conifa. Er hat sich für Abchasien eingesetzt – "die Begeisterung dort" habe ihn überzeugt.
Das Projekt Conifa wird nur von einer Handvoll Überzeugungstätern wie ihm vorangetrieben – das strengt an. Zumal er bei dem Turnier ganz auf die Gastgeber angewiesen ist. Nach Conifa-Regeln trägt dieser alle Kosten eines Turniers, außer den Flugtickets, für diese kommen die Mannschaften selbst auf. Ein Budget hat die Conifa nicht, ein Gehalt bekommen Düerkop und seine Mitstreiter ebenso wenig. Den Verband hat er aus Fußballbegeisterung mitgegründet. Düerkop sammelt Fußballtrikots. 300 hat er bereits.
Sascha Düerkop sieht abgekämpft und zufrieden aus, als er die vielen glücklichen Gesichter auf der Tribüne anschaut. Auf dem Feld dominiert der Gastgeber im ersten Spiel gegen die Außenseiter von den Chagos-Inseln. "Die bereiten sich seit drei Jahren vor und sammeln das Geld, um herfliegen zu können", sagt er.
Die Bewohner der Chagos-Inseln wurden in den 1960er-Jahren aus ihrer Heimat vertrieben und weggelockt, damit Großbritannien das Archipel im Indischen Ozean an die USA verkaufen konnte, die dort eine große Militärbasis errichtet haben. Die meisten von ihnen leben in London, viele prozessieren seit Jahren gegen ihre erzwungene neue Heimat Großbritannien. Mittlerweile setzt sich die prominente Menschenrechtlerin Amal Clooney für sie ein. Und nun absolviert das Fußballteam der Chagos-Inseln ein richtiges Turnier. Es sind Schicksale wie diese, die Sascha Düerkop begeistern.
Eine andere Geschichte erzählt er auch gerne, die von der ersten Conifa-WM 2014 in Schweden. "Es kam die Mannschaft aus der Krisenregion Darfur. Die haben zum ersten Mal auf Rasen gespielt." Sportlich war da wenig. "Aber es war ein Erfolg, dass die überhaupt gekommen waren", sagt Düerkop. "Und dass sie alle da geblieben sind, in Schweden", fügt er hinzu und schmunzelt. Als er die Polizei darüber informierte, dass die Spieler nicht mehr da waren, habe die gesagt: "Schweden ist ein freies Land. Wenn die Leute wirklich aus Darfur kommen, sollen sie Asyl beantragen." Abchasien gewinnt gegen die Chagos-Inseln übrigens 9:0. Es ist Nacht geworden in Suchumi.
Vor einem Seitenflügel des ehemaligen Regierungsgebäudes, gebaut im sowjetischen Stil, eine Ruine, seit die Abchasen 1993 die georgische Armee dort rausgebombt haben, steht am nächsten Morgen Rafael Ampar an einer Wand mit faustgroßen Einschlusslöchern und macht, was er immer macht: Er raucht und organisiert. Ampar wirkt nachdenklich, aber optimistisch, wenn er über die Zukunft Abchasiens redet. "Wir sind ein kleines Volk. Aber wir machen weiter", sagt Ampar. Weiter, das heißt weiter den eigenen Weg suchen, an der Seite des allzu großen Bruders Russland. Er weiß, dass manche jungen Abchasen nach Russland umsiedeln.
Zur Gruppe um Ampar gehört auch Dascha, eine 23-Jährige, die gut Englisch spricht und bei der WM freiwillig übersetzt. "In Russland sind alle überarbeitet, alles ist so gehetzt. Ich will das nicht." Dascha arbeitet als Kulturwissenschaftlerin beim Staat und verdient weniger als 100 Euro im Monat. Einiges stört sie aber mehr als ihr mickriges Gehalt. "Es gibt in Suchumi ein Theater, aber die Auftritte sind selten. Und ein Kino gibt es im ganzen Land nicht!" Dass es nicht vorwärtsgeht, erklärt Dascha mit schlechter Organisation. "Ich habe mich als Freiwillige für die WM gemeldet. Vor einem Monat. Die haben mich am Tag der Eröffnung zurückgerufen: Komm schnell, es gibt was zu tun!" Dascha überlegt kurz und fügt hinzu: "Trotzdem: mir geht es hier gut." Die Uhren ticken anders in Abchasien.
Spontan hat auch der Staatspräsident noch Zeit gefunden, um am Rande der WM mit den wenigen Journalisten zu reden. Raul Chadschimba spricht mit sanfter Märchenerzählerstimme, sein Lächeln ist gewinnend, seine Aussagen vage. Ob diese WM denn nicht kontraproduktiv sei, weil sie beweise, dass sein Land von kaum einem Staat anerkannt werde, wird er von einem Reporter vom Guardian gefragt. Chadschimba lässt einige Sekunden verstreichen und sagt dann: "Wir haben uns selbst anerkannt, das ist das Wichtigste. Alles andere wird kommen."