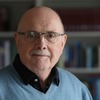Stadtgeschichte
Das Friedensheim in Lahr bildete ein einzigartiges Arbeitermilieu
Das Friedensheim in Lahr ist ein besonderes Wohngebiet. Ursprünglich als Kaserne geplant, entwickelte es sich später zu einer Arbeitersiedlung. Heute handelt es sich um ein normales Wohngebiet.
Mo, 14. Apr 2025, 9:30 Uhr
Lahr
Thema: Gebäude und ihre Geschichte
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen
Die Stadt Lahr sollte die Kaserne auf 30 Jahre zu einem Mietpreis von 11.000 Mark vermieten. Der Lahrer Stadtrat empfahl dem Bürgerausschuss, der am 10. Juli 1912 zusammentrat, dem Vorhaben zuzustimmen. Bei der Sitzung waren 70 der 109 Stadtverordneten anwesend. Oberbürgermeister Gustav Altfelix, der Stadtverordnetenvorstand und die Mehrheit der Mitglieder des Bürgerausschusses waren überzeugt, dass die militärische Verstärkung zum weiteren Aufblühen der Stadt beitragen würde. Widerstand kam von den Sozialdemokraten. Wilhelm Laub und Stadtrat Gustav Richter meldeten sich zu Wort, wobei Richter dem Gremium "Hurrapatriotismus" vorwarf. Der Vorlage stimmten 62 Stadtverordnete zu. Alle acht Gegenstimmen kamen von den Sozialdemokraten.
Für den nun beginnenden Bau der zweiten Artilleriekaserne im Bereich des Benzentals und des Gugis erhielt der Rastatter Architekt Paul Oehler die Bauleitung. Die Bauarbeiten verliefen schleppend und konfliktreich. Im November 1914 wurden sie sogar vorübergehend eingestellt. Oehler kündigte frustriert seinen Vertrag, ein neuer Bauleiter namens Hotz führte die Arbeiten weiter. Mitte 1915 war die zweite Artilleriekaserne fertiggestellt. Wegen des Kriegsverlaufs und des verheerenden Kriegsendes wurden die neuen Bauten nie übergeben. Mit dem Kasernenauflösungsvertrag vom 13. Dezember 1920 erlosch der Pachtvertrag mit der Stadt. Die Kaserne wurde an die Stadt zurückgegeben.
Nach dem Ersten Weltkrieg schrieb der Versailler Vertrag eine 50 Kilometer breite entmilitarisierte Zone vom Rhein in Richtung Osten vor. Die Stadt Lahr war zur ersten großen Konversion militärischer Anlagen gezwungen. Die zweite Artilleriekaserne wurde deshalb größtenteils zu Wohnzwecken umgebaut. Träger des Bauvorhabens war die am 29. April 1920 gegründete Arbeiter-Baugenossenschaft Lahr eG, die sich zum Ziel gesetzt hatte, preisgünstige Wohnungen für einkommensschwache Bürger zu schaffen. In einer Versammlung am 27. April 1920 in der Aula der Luisenschule, zu der viele Arbeiter gekommen waren, wurde über den schlechten Zustand vieler Wohnungen und die allgemeine Wohnungsnot geklagt. Treibende Kraft bei der Gründung war die zentrale Figur der Lahrer Arbeiterbewegung, Gustav Richter.
Mit Unterstützung der Stadt Lahr entstanden die ersten Genossenschaftswohnungen. 87 ehemalige Stallbauten des Feldartillerie-Regiments gingen durch Schenkung der Stadt Lahr an die neu gegründete Genossenschaft, verbunden mit der Auflage, sie zu Einfamilienhäusern umzubauen. Bereits 1920 konnten die ersten Mieter in die neue Wohnsiedlung einziehen. Der Kasernenhof wurde in die Planung einbezogen. Er wurde umgestaltet, in kleine Parzellen aufgeteilt und den Mietern zum Gemüseanbau zur Verfügung gestellt. Inmitten des "Friedensheim-Straßenkarrees" bestehen die Kleingärten heute noch.
1927 hatte die Arbeiter-Baugenossenschaft 320 Mitglieder. 159 Wohnungen, darunter 113 Einfamilienhäuser waren inzwischen entstanden. In der Arbeitersiedlung Friedensheim entwickelte sich ein einzigartiges Arbeitermilieu. SPD und KPD hatten hier ihre Hochburgen. Es war eine Art Gegenkultur. Wer im Friedensheim wohnte, war wie selbstverständlich Teil eines Netzwerks aus Gewerkschaften, Arbeitervereinen und politischen Parteien. Politische Heimat war vor allem die Sozialdemokratie. Man war sich bewusst, dass die Interessen der Arbeiterschaft nur in einer Arbeiterorganisation vertreten werden konnten. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung entwickelten ein Gefühl der "Zusammengehörigkeit in einer Solidargemeinschaft".Das Wahlverhalten der Friedensheimer wirkte noch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg nach, hat sich aber inzwischen stark verändert. Die früher weitgehend geschlossene Solidargemeinschaft existiert heute nicht mehr.
In der nationalsozialistischen Zeit war dieser Stadtteil ständigen Angriffen der NSDAP ausgesetzt. Provokationen und Schlägereien waren an der Tagesordnung. In der benachbarten Malerfachschule waren SA-Einheiten stationiert, um Kontrolle auszuüben. 1943 fusionierte die Arbeiter-Baugenossenschaft mit der Wohnungsbaugenossenschaft Lahr und der Baugenossenschaft Dinglingen zur Baugenossenschaft Lahr.
Am 19. Februar 1945 kam es zu einem verheerenden Luftangriff: 64 Flugzeuge warfen 250 Bomben ab, vor allem auf die Serre-Kaserne und das Friedensheim. Die Stadt Lahr erlebte den schwersten Fliegerangriff des Zweiten Weltkriegs. Im Friedensheim starben mehrere Familien im Bombenhagel, Kinder wurden verschüttet. Der damalige Vorstand der Baugenossenschaft Lahr und 21 weitere Menschen kamen ums Leben, darunter vier Kinder des Sozialdemokraten Kamill Delfosse, der zu dieser Zeit inhaftiert war. Warum ausgerechnet das Friedensheim neben der Serre-Kaserne zum Ziel der Bomber wurde, ist bis heute nicht geklärt. Der Lahrer Stadtarchivar Thorsten Mietzner vermutet, dass es sich entweder um einen Irrtum der Luftaufklärung handelte oder dass die Bomber vor dem Rückflug noch ihre Last loswerden wollten.
Das Friedensheim ist heute mit 74 Einfamilienhäusern und einigen Mehrfamilienhäuser ein großes zusammenhängendes Wohngebiet der Baugenossenschaft Lahr, deren Objekte sich über das ganze Stadtgebiet verteilen. Die Genossenschaft bewirtschaftet und verwaltet rund 730 Wohnungen. Um den Bestand zu modernisieren, muss sie hohe Instandhaltungsaufwendungen einplanen.