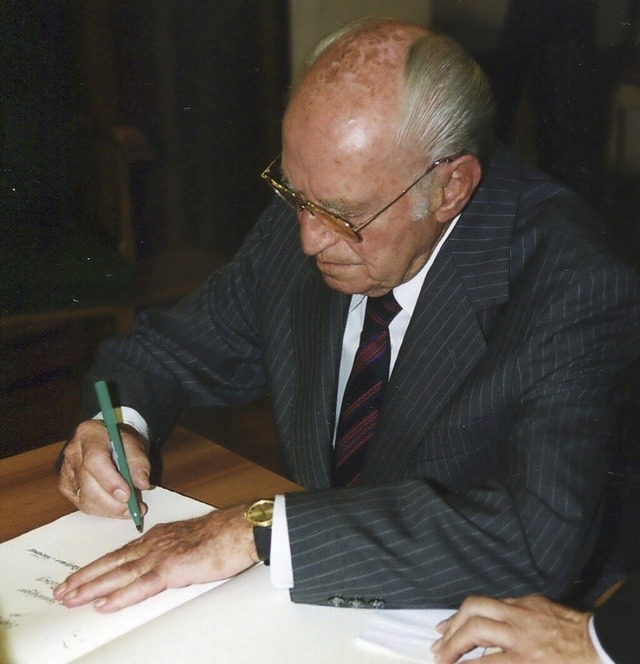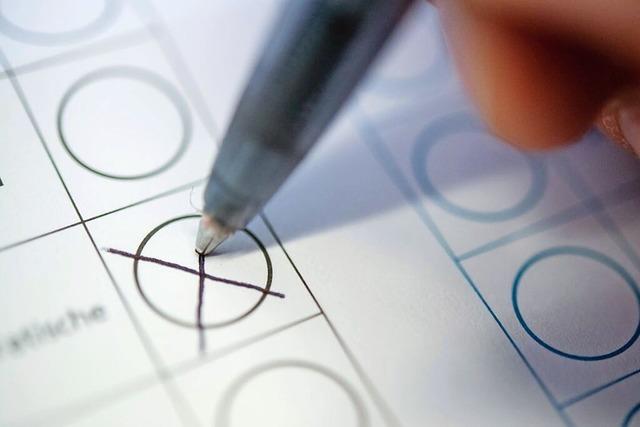BZ-Serie
Wettrennen auf Berge und übers Eis
Viele Straßen in Titisee-Neustadt sind besonderen Persönlichkeiten gewidmet. In einer Serie schaut die BZ auf ihre Namensgeber. Diesmal geht es um den Rennfahrer Paul Pietsch.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen
Mit 14 Jahren, so berichtete Paul Pietsch 1991, anlässlich seines 80. Geburtstages, habe er beschlossen, später einmal "irgendetwas mit Autos" machen zu wollen. Dieser vage Wunsch wurde Wirklichkeit, traumhafter, als sich der Junge es wohl je vorgestellt haben mochte. Paul Pietsch wurde in den 1930er- und 1940er Jahren ein berühmter und erfolgreicher Rennfahrer, gründete nach dem Krieg den Stuttgarter Motorpresse-Verlag und wurde anlässlich seines 90. Geburtstages 2001 zum Neustädter Ehrenbürger ernannt.
1911 in Freiburg geboren, verbrachte Paul Pietsch seine frühe Jugend in Friedenweiler, wo sein Vater die Fürstlich Fürstenbergische Brauereiniederlassung leitete, bis dann im Ersten Weltkrieg deren Kupferkessel eingeschmolzen wurden. Die Pietschs zogen nach Neustadt und eröffneten 1919 auf dem Gelände der einstigen Tuchfabrik eine Getränkeniederlassung. Der Vater starb früh, schon 1925, sodass die Mutter das Geschäft alleine führen musste. Denn der junge Paule, gerade mal 14 Jahre alt, sauste schon damals lieber mit dem Motorrad über die Landstraßen, obwohl er noch keinen Führerschein besaß.
Als ihm jedoch zu seinem 20. Geburtstag ein größerer Geldbetrag aus dem väterlichen Erbe ausgezahlt wurde, kaufte er auf eigene Faust bei Ettore Bugatti in Molsheim bei Straßburg einen gebrauchten Rennwagen. Der berühmte Autobauer nahm den jungen Schwarzwälder sogar in sein Rennteam auf und ließ ihn bei zunächst regionalen Wettbewerben an den Start gehen. 1932 startete Pietsch bei einem Flugplatzrennen in Wiesbaden, danach beim sogenannten Kesselbergrennen, wo er erstmals mit den ganz Großen der Branche um die Wette fuhr und eine hervorragende Figur abgab. Hinter Rudolf Carraciola und dem Schweizer Stuber wurde er Dritter. Seinen ersten Sieg holte er 1933 bei einem Eisrennen in Schweden. Von da an gehörte er ganz und gar zum europäischen Rennzirkus.
Beim Schauinslandrennen 1933 schaffte er hinter dem Schweizer Stuber mit nur neun Sekunden Rückstand den zweiten Platz auf einem Alfa Romeo. Spätestens jetzt hatte ihn auch die Heimatstadt Neustadt als glänzenden Werbeträger entdeckt. Nach der Rückkehr vom Schauinslandrennen wurde er im August 1933 von der Stadtmusik mit einem Ständchen und vom Bürgermeister und Gemeinderat mit einem Festakt empfangen. Der damalige Motorsport war ein Faszinosum ersten Ranges. Spektakulär waren die Rennen und hautnah das Publikum dabei. Paul Pietsch fuhr Bergrennen, Rundkurse, Eisrennen mit selbstgebastelten Spikes und am Stilfser Joch mit handgeschnittenem Stollenprofil. Mit dem berühmten Flieger Ernst Udet wettete Paul Pietsch eines Tages, wer wohl der Schnellere sei: Pietsch mit Spikes auf dem vereisten Eibsee oder Udet mit einem Flieger in der Luft. Pietsch gewann die Wette.
Mit dem Wechsel zu Maserati 1937 bekam Pietschs Rennfahrerkarriere einen internationalen Charakter. Beim Großen Preis von Deutschland 1939 auf dem Nürburgring bot er den weit überlegenen und favorisierten deutschen Silberpfeilen Paroli und landete trotz Kerzenschaden auf dem dritten Platz. In der Rückschau betrachtete Pietsch dies als seinen größten Erfolg, und es war auch sein vor dem Krieg letzter, denn dann brach der Zweite Weltkrieg aus und die Rennfahrerkarriere war zu Ende. Pietsch genoss trotz seiner sportlichen Erfolge keine Sonderprivilegien, er wurde zur Wehrmacht eingezogen, kam an die Front, wurde mehrfach verwundet und landete schließlich in amerikanischer Gefangenschaft.
Als er 1946 in seine geschlagene Heimat zurückkehrte, war an Autorennen nicht zu denken. Aber sein Traum blieb der Motorsport, und so kam er bald auf die Idee, mit seinem Freund Ernst Trötsch zusammen eine Motorsportzeitschrift herauszugeben. Das erste Heft von "Auto" erschien 1946. Der französische Presseoffizier, der die Lizenz zu vergeben hatte, gab dem Unternehmen wenig Überlebenschancen. Er vertrat die Auffassung, dass es in Deutschland nie wieder so viel Autos geben werde, dass sich eine Autozeitschrift lohnen könnte.
Der Franzose sollte sich gewaltig irren. Schon 1950 zog Paul Pietsch mit seinem Motorpresse-Verlag von Freiburg nach Stuttgart um. Dort hat das moderne Verlagshaus noch heute seinen Sitz und ist mit rund 140 nationalen und internationalen Zeitschriftentiteln, mit Buchpublikationen und diversen Beteiligungen zu einem führenden Imperium der Motorpresse geworden.
Anfangs fuhr Paul Pietsch auch noch selber Rennen, er wurde Deutscher Sportwagenmeister 1950 und Deutscher Rennwagenmeister 1951, auf Fahrzeugen, deren Namen heute Legende sind, einem Maserati und einem Veritas Meteor. Von schweren Verletzungen blieb Paul Pietsch während seiner ganzen Karriere verschont, obwohl es an Überschlägen und Ausfällen jeglicher Art nicht gefehlt hat. Am spektakulärsten war ein Abflug 1952 auf der Steilwandkurve der Berliner Avus. Ein Jahr später, mit 43 Jahren, beendete Paul Pietsch seine Rennfahrerkarriere.
Den Verlag hat Paul Pietsch Verlag bis ins hohe Alter selbst geleitet. Als er 1991 von der Stadt Titisee-Neustadt zum Ehrenbürger ernannt wurde, gab er auch einiges aus seinem Privatleben preis. So freute er sich über die Umbenennung eines kleinen Fußweges zu seinen Ehren. Das war nämlich sein Schulweg von der Realschule zum Elternhaus. "Dass dort keine Autos fahren dürfen, das stört Sie hoffentlich nicht", entschuldigte sich Bürgermeister Martin Lindler scherzhaft beim Festakt zu Paul Pietschs Achtzigstem, als der Bollenweg umbenannt wurde. Paul Pietsch störte es nicht. Er übergab der Stadt eine Spende in Höhe von 25.000 Mark für einen sozialen Zweck. Er starb 2012 drei Wochen vor seinem 101. Geburtstag in seinem Altersruhesitz in Karlsruhe.