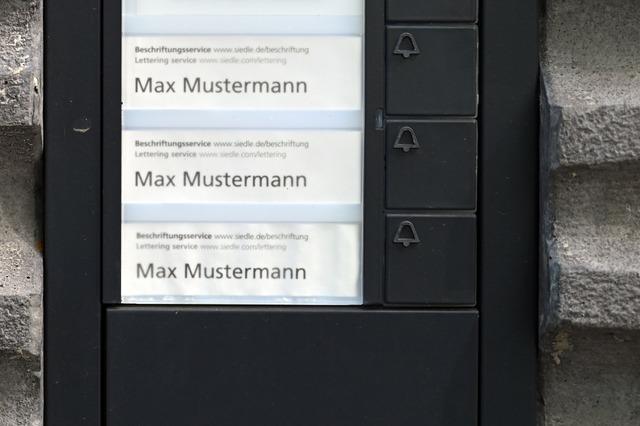"Ich bin ihm bis in alle Ewigkeit dankbar"
IM PROFIL: Mohamed Helmy wird posthum als erster Araber von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Judenretter geehrt.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen

Aber es gingen Jahrzehnte ins Land, bis auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem von diesem außergewöhnlichen Fall erfuhr. Sie hat 2013 Mohamed Helmy posthum als "Gerechten unter den Völkern" anerkannt. Es war das erste Mal, das einem Araber eine solche Ehrung zugesprochen wurde. Nur mochte zunächst niemand aus dessen ferner Verwandtschaft in Ägypten die Einladung zu einer Feierstunde in Israel annehmen.
Jetzt findet die Zeremonie doch noch statt – und zwar an diesem Donnerstag in der Akademie des Auswärtigen Dienstes in Berlin. Dort wird der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, dem Großneffen Helmys Medaille und Ehrenzertifikat überreichen. Nasser Kutbi, ein 81-jähriger Medizinprofessor aus Kairo, hat sich bereit erklärt zu kommen, weil er sich noch gut erinnere, wie harmonisch einst Juden, Muslime und Christen in Ägypten zusammenlebten – ein würdiger Vertreter seines couragierten Onkels.
Mohamed Helmy war 1922 zum Medizinstudium nach Berlin gegangen und hatte anschließend als Urologe im Robert-Koch-Institut gearbeitet. Als nach Hitlers Machtergreifung seine jüdischen Kollegen gefeuert wurden, machte er kein Geheimnis daraus, wie wenig er von der NS-Rassenideologie hielt. Als "Nicht-Arier" eingestuft, geriet Helmy selbst unter den Druck des Regimes. Die Nazis untersagten ihm, seine deutsche Verlobte zu heiraten. 1938 verlor auch Helmy seinen Job, später wurde er in Arrest geschickt, aber wegen seiner angeschlagenen Gesundheit wieder freigelassen. Das alles hielt ihn nicht davon ab, jüdischen Freunden zu helfen.
Nach dem Beginn der Deportation von Juden aus Berlin im Oktober 1941 brachte Helmy kurz entschlossen die 21-jährige Anna Boros in seiner Gartenhütte in Sicherheit. Die Laubenkolonie in Berlin-Buch diente ihr bis zum Kriegsende als Versteck. Die Gestapo hatte Helmy mehrfach im Verdacht. Wenn die Lage besonders brenzlig wurde, besorgte er Anna für einige Tage einen Unterschlupf bei Freunden, denen er sie als Cousine vorstellte. Zur Tarnung trug sie ein Kopftuch – und gab sich als Ehefrau eines Muslims aus.
Auch ihrer Familie verschaffte der ägyptische Arzt gemeinsam mit der Berlinerin Frieda Szturmann, die ebenfalls vor vier Jahren von Yad Vashem als "Gerechte unter den Völkern" anerkannt wurde, eine Zuflucht. 1944 wurden Annas Mutter und der Stiefvater allerdings geschnappt. Unter dem brutalen Verhör gestanden sie, Helmy sei ihr Helfer. Der bewies Nervenstärke und ließ Anna auf der Stelle aus der Laube holen. Sie konnte fürs erste bei Frieda Szturmann unterschlüpfen, die sich auch um die Großmutter der Boros kümmerte, bis die Luft wieder rein war. Helmy hatte für den Fall, dass die Polizei ihm auf die Schliche kommen sollte, vorsorglich einen Brief von Anna in der Tasche, wonach sie bei einer Tante in Dessau wohne. Dank seines Mutes und seiner Umsicht überlebten alle vier Familienmitglieder den Holocaust.
Nach dem Krieg emigrierte Anna Boros in die USA und nahm den Ehenamen Gutman an. Helmy blieb bis zu seinem Tod 1982 in Berlin. Erst 2012 erhielt die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem Hinweise eines Berliner Ehepaars, das bei Nachforschungen über ein Wohnhaus in der Krefelder Straße auf einen ägyptischen Arzt gestoßen war, der Juden gerettet haben solle. Die Spurensuche führte zu alten Briefen im Archiv des Berliner Senats. Die Geschichte zog Kreise. Schließlich meldete sich Carla, die Tochter der längst verstorbenen Anna Boros-Gutman aus USA. "Es ist nicht nur meine Mutter, die Dr. Helmy gerettet hat. Auch wir, ihre drei Kinder und sieben Enkelkinder verdanken ihm unser Leben."
26 000 Namen sind mittlerweile im "Garten der Gerechten" eingraviert. Vielleicht, hoffen die Yad-Vashem-Forscher, wird Helmy nicht der einzige Araber bleiben – nach Bekanntwerden seiner Geschichte könnten sich womöglich Zeugen weiterer Fälle melden.