Rezension
Sachbuch "Ungleich vereint": Ostdeutschland ist eine andere Gesellschaft geworden

Fr, 21. Juni 2024, 13:50 Uhr
Literatur & Vorträge
"Ungleich vereint" ist Deutschland, stellt Steffen Mau in seinem neuen Buch fest. Wo liegen die Gründe für die tiefe politische Spaltung zwischen Westen und Osten? Und wie kann diese überwunden werden?
Bei der Europawahl ist es wieder deutlich geworden: Mit bis zu 40 Prozent der Stimmen ist die AfD im Osten fast flächendeckend die stärkste Partei. Mau beschreibt es so: "Ostdeutschland mangelt es bis heute an einem robusten sozialmoralischen und sozialstrukturellen Unterbau, der Toleranz, ein emphatisches Demokratieverständnis und ein Bekenntnis zu den Prinzipien der liberalen Ordnung tragen könnte."
"Ungleich vereint" ist eine Fortschreibung von Maus Buch "Lütten Klein", in dem er die ostdeutsche "Transformationsgesellschaft" nach der Revolution von 1989 analysiert hat. Mau, Jahrgang 1968, ist in Rostock aufgewachsen, er lehrt heute als Professor für Soziologie an der Berliner Humboldt-Universität. Zuletzt hat er mit Kollegen die vielbeachtete Studie "Triggerpunkte" veröffentlicht.
In Ostdeutschland hat sich, so Mau, mittlerweile aus der Transformations- eine Posttransformationsgesellschaft entwickelt. Statt sich wie erhofft an den Westen anzugleichen, hat der Osten einen eigenen Entwicklungspfad genommen. Es gibt Unterschiede, deren Verschwinden unwahrscheinlich ist.
Noch immer gilt das für die Wirtschafts- und Sozialstruktur: "Im Vergleich beider Teilgesellschaften ist Westdeutschland mittelschichtiger, Ostdeutschland hingegen eine einfache Arbeitnehmergesellschaft, ja ein ‚Land der kleinen Leute‘", konstatiert Mau. Es gibt im Osten mehr Beschäftigte mit manuellen Tätigkeiten und im Dienstleistungssektor, weniger Angestellte und Managementtätigkeiten.
Gesellschaftliche Führungsgruppen, die den vorpolitischen Raum gestalten, gebe es daher kaum. Das bürgerschaftliche Engagement sei weniger vielfältig und bunt und schlechter ausgestattet. Ein Beispiel: Von den 25.000 Stiftungen in Deutschland sitzen nur sieben Prozent im Osten.
Kommunalpolitiker sind im Osten häufiger parteilos als im Westen, es entstehen lokale Wählergemeinschaften, die nicht nur in Einzelfällen aus der Freiwilligen Feuerwehr hervorgehen. Das ist ein Einfallstor für Rechtsextreme: "Personen mit völkischen und rechtsnationalen Überzeugungen" sind , so Mau, "zu Funktionsträgern in Einrichtungen wie der Freiwilligen Feuerwehr oder der Handwerkskammer geworden".
Auch die AfD hat sich auf diese Weise eingenistet. Und mit ihren Botschaften macht sie sich zum "Sprachrohr der ‚ostdeutschen Seele‘", bietet eine "mentale Beheimatung" an, bedient die Sehnsucht nach Stabilität und Zugehörigkeit. Vielerorts hätten sich, sagt Mau, im Osten "Festhaltementalitäten" herausgebildet: "Nachdem man sich schon einmal grundlegend umstellen musste und biografische Halterungen wegbrachen, stemmen sich nun größere Bevölkerungsgruppen stark gegen neue Zumutungen." Vor allem die Migration geht "mit einem diffusen Gefühl des Kontrollverlusts einher". Nicht, dass man das nicht auch im Westen verspüren kann. Aber im Osten ist es eingebettet in die "Grundstimmung einer veränderungserschöpften Teilgesellschaft", wie es Mau formuliert.
Was tun? Mau plädiert für die Einrichtung von Bürgerräten, anknüpfend an die Runden Tische der Wendezeit, die bei den Ostdeutschen "mit positiven Erinnerungen an politische Selbstwirksamkeit verbunden" seien. Sie könnten auf Gemeinde-, Kreis- oder Landesebene angesiedelt werden und Fragen der Infrastruktur und Investitionsvorhaben verhandeln. "Im Gegensatz zu Wahlen, bei denen es um reine Willensbekundung geht", so Mau, stünden hier "Prozesse der Willensbildung" im Vordergrund. Er sieht die Räte als Ergänzung der repräsentativen und der Parteiendemokratie. Sie könnten zu Lernorten der Demokratie werden.
Was langfristig gedacht ist. Kurzfristig aber, das sieht auch der Sozialwissenschaftler, kommt es darauf an, was die anderen Parteien politisch machen, wenn die AfD auch bei den Landtagswahlen im Osten im Herbst stärkste Partei werden sollte. Alles hänge dann ab vom Geschick, Mehrheiten gegen die AfD herzustellen, so Mau.







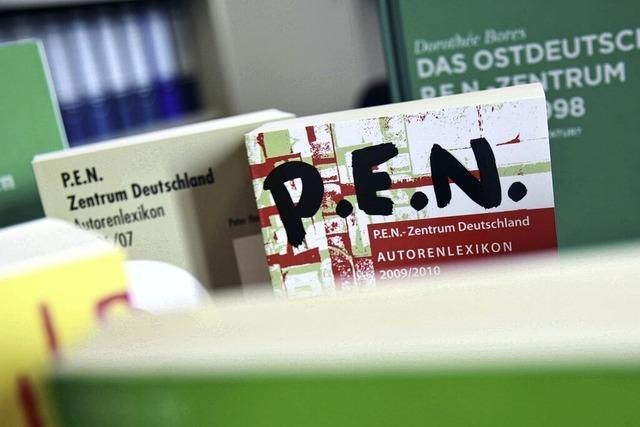

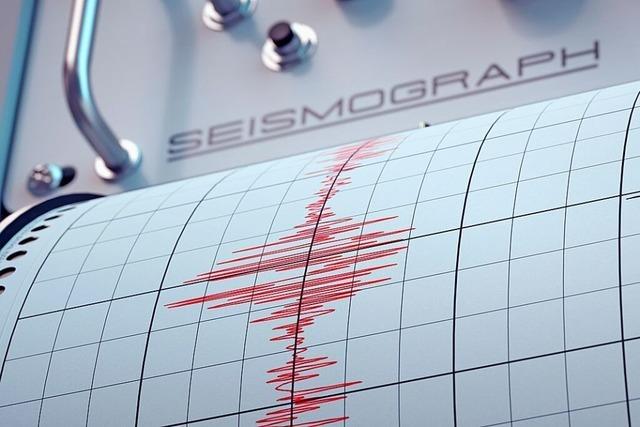


Kommentare (5)
Um Artikel auf BZ-Online kommentieren zu können müssen Sie bei "Meine BZ" angemeldet sein.
Beachten Sie bitte unsere Diskussionsregeln, die Netiquette.
Sie haben noch keinen "Meine BZ" Account? Jetzt registrieren