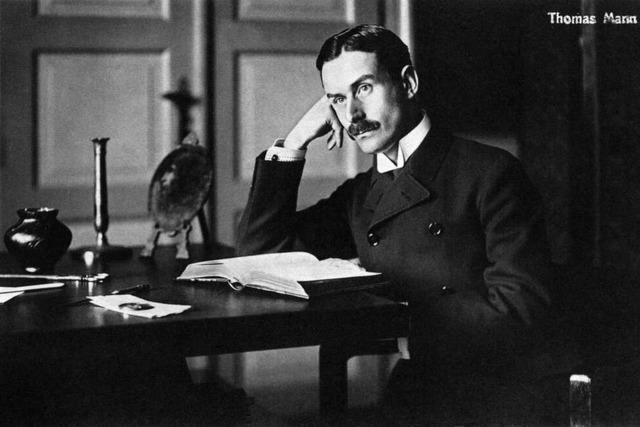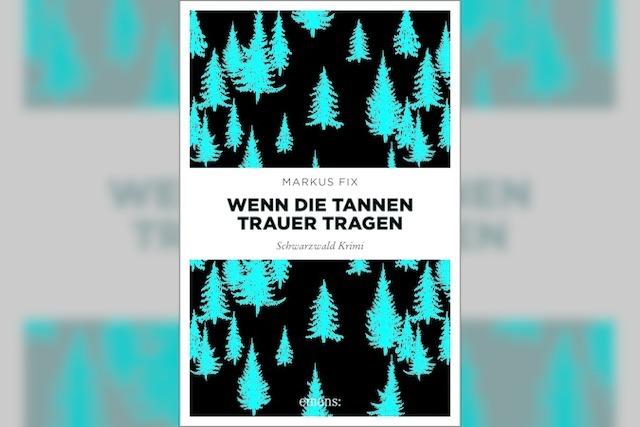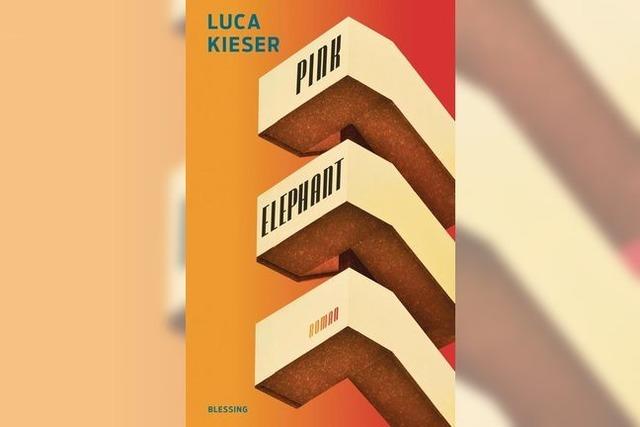Sachbuch
Im Osten anders als im Westen: Wie Christina Morina Demokratie in ihrem Buch "Tausend Aufbrüche" beschreibt
Vor zwei Wochen bekam sie für ihr Buch "Tausend Aufbrüche" den Deutschen Sachbuchpreis. Nun kommt die Historikerin Christina Morina zu einem Vortrag über die deutsche Demokratie an die Uni Freiburg.
Fr, 28. Jun 2024, 11:30 Uhr
Literatur & Vorträge
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen

Die Jurorinnen und Juroren hätten es auch so sagen können: "Tausend ...