Ein Doppelagent im Kunstbetrieb
Das Museum Frieder Burda zeigt Banksys Schredder-Bild.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen
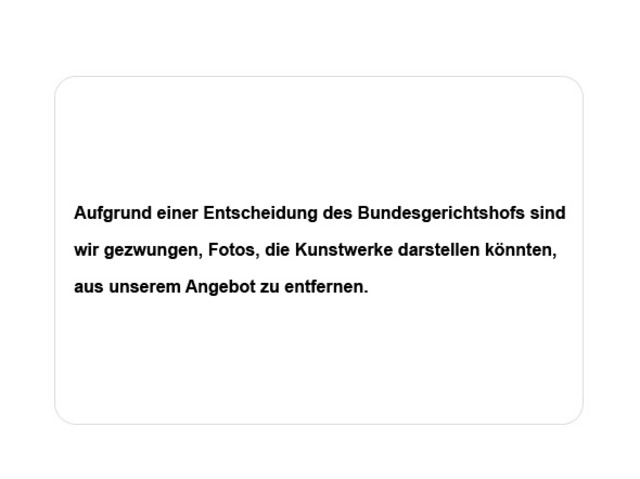
Andererseits: Was heißt hier schon Zerstörung? War es nicht eher ein Akt der geplanten Obsoleszenz, durch den Banksys ikonisches Stencil "Girl With Balloon" – ein millionenfach im Netz und als Postkarte kursierender Klassiker des romantischen Urbanismus – zu schmalen Streifen weiterverarbeitet wurde, so dass man im ersten Moment denken konnte: Hoppla, Street Art mit Vollbart, wie charmant! – um sich im zweiten Moment zu fragen: Ist das nun Kunst? Oder Kunstmarktkritik? Ist das Kitsch, Radical Chic oder eine besonders subtile Form von Polit-Entertainment?
Die bei der Auktion anwesenden Bieterinnen und Bieter, die Assistenten mit ihren weißen Handschuhen und an den Telefonen wirkten in den vielfach geposteten Videomitschnitten der Auktion jedenfalls keineswegs schockiert, wie viele Medien später berichteten, sondern auf eine geradezu erwartungsfrohe Weise belustigt. Dass der Schredder hier nur halbe Arbeit leistete, war laut Aussage des Künstlers einem Defekt des Gerätes geschuldet. Das mag stimmen – oder auch nicht. Tatsächlich schuf der Zerkleinerer die überaus dekorative Ansicht einer Teilzerstörung, um die sich künftig die Konservatoren der Staatsgalerie Stuttgart werden kümmern müssen. Ihr hat die anonyme Sammlerin ihren Banksy ab März als Dauerleihgabe überlassen. Man kann es smart nennen, die Instandhaltung dieses stilvoll derangierten Relikts einer medienwirksam inszenierten Rückverwandlung von der Kopie in ein Original der öffentlichen Hand zu überantworten. Dass sich Museen tatsächlich darauf einlassen, verrät viel über die Bedingungen des Wettbewerbs um Aufmerksamkeit und Besucherzahlen, in dem derzeit viele Häuser stehen.
Die vierwöchige Präsentation der Arbeit im Museum Frieder Burda wird nicht zufällig von einer robusten Medienkampagne begleitet, die das Publikumsinteresse schon im Vorfeld kräftig anheizte. Vorträge, Führungen und ein Experten-Talk sollen darüber hinaus Anregungen zum korrekten Verständnis des Schredderobjekts als "neue globale Ikone" und als "Attacke auf den Kunstbetrieb" geben. Doch das Zählwerk im Museum Frieder Burda könnte auch aus einem anderen Grund heißlaufen: Nach dem Willen des Künstlers ist "Love is in the Bin" außerhalb des ticketpflichtigen Bereichs zu sehen, also gratis – oder wie Banksy das nennt: unlimitiert, gewissermaßen in der demokratischen Zone.
Die Behauptung, dass sich sein Bild damit außerhalb der Verwertungslogik des Kunstbetriebs bewegen würde, wäre jedoch verwegen. Das Gegenteil ist der Fall. Die geschredderte Leinwand benötigt das Museum für den Prestigegewinn auf ähnlich dringende Weise als Bühne wie die "Zerstörung" des Bildes ihre volle Wirksamkeit erst im hoch emotionalisierten, von Spektakel, Konkurrenz und Begierde geprägten Rahmen einer Auktion entfalten konnte. Warum sonst sollten wir uns "Love is in the Bin" statt auf Instagram direkt in Baden-Baden ansehen wollen, wenn wir nicht hoffen würden, vor dem Original das Knistern des Geldes zu hören, das die Messer des Reißwolfs in Bewegung setzte; und wenn wir nicht die heimliche Aufregung spüren wollten, die es bedeutet haben mag, mit dieser generalstabsmäßig geplanten Inszenierung der Welt die Augen zu öffnen für die Absurditäten eines hohl drehenden Kunstmarktes, aber die eigene Beteiligung an eben diesem Spiel zu verschweigen?
Darin liegt die seltsame Ambivalenz von Banksys Schredder-Coup. Im vorgeblichen Kampf um die Befreiung der Kunst aus den Fängen des Marktes agiert der Brite, der gerne anonym bleibt, wie ein Doppelagent. Selbst längst als Publikums- und Medienliebling im und außerhalb des Kunstbetriebs etabliert, gilt er zugleich als Star des Anti-Art-Establishments. Paradox? Mag sein. Die Kunst, diesen Widerspruch so reibungslos zu performen, verdankt sich vor allem einer Qualität: professionellem Marketing.











