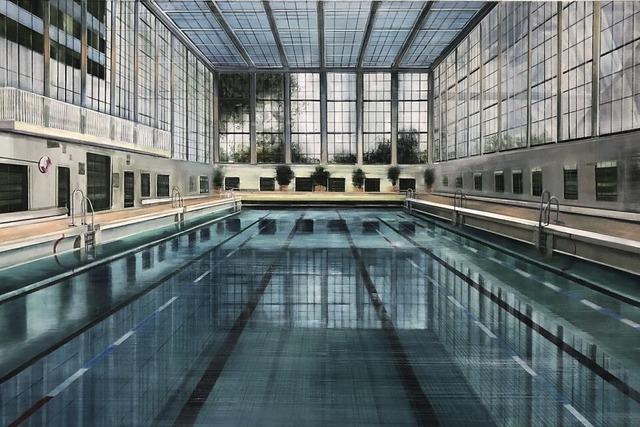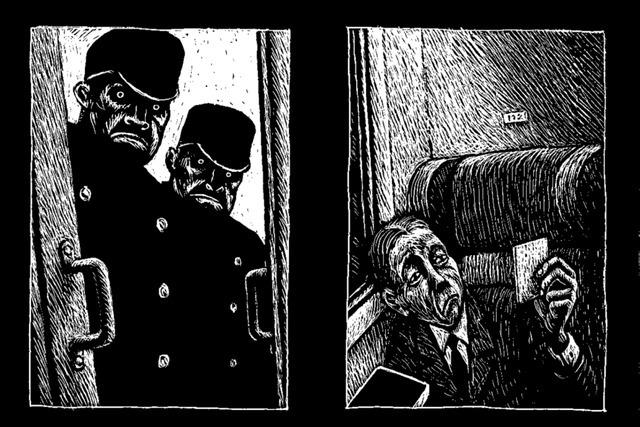Ausstellung
Das Basler Kunstmuseum zeigt mit "Verso" die oft überraschende Kehrseite von Gemälden
Das Kunstmuseum Basel lenkt mit der Ausstellung "Verso" den Blick auf die Rückseite von Gemälden. Die sind mal ikonografische Entdeckungen, gar postume Enthüllungen.
Di, 18. Feb 2025, 20:00 Uhr
Kunst
Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen
Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.
AkzeptierenMehr Informationen